- VIER -
Der geschäftliche Erfolg ging allerdings mit unerfreulichen Entwicklungen im Privatleben einher. Nach außen, im Umgang mit Fremden, konnte der Alte Herr außerordentlich charmant, weltgewandt und vertrauenerweckend sein. Doch im vertrauten Kreis verhielt er sich reserviert ausgerechnet gegenüber denen, die ihm am nächsten standen, mit Ausnahme seiner Frau, nach der er geradezu verrückt war und der er nichts abschlagen konnte. Mit der Erziehung der Kinder und der Beaufsichtigung des großen Haushalts wollte er möglichst wenig zu tun haben, diese Dinge überließ er am liebsten seiner Frau, und als sich zeigte, dass sie ihrer Verantwortung nicht wirklich nachkam, holte er eine Gouvernante ins Haus. Meine Großmutter, schon von Natur aus sehr auf Selbständigkeit bedacht und voller Aversionen gegen jede Art von Autorität, fühlte sich nämlich mit diesem Tycoon als Ehemann dazu berufen, in der Öffentlichkeit die superemanzipierte Frau zu spielen.
So unternahm sie regelmäßig unangekündigte Reisen, oft zu den Landgütern von Freundinnen in Kurland, wo die Damen, mit meiner Großmutter als Wortführerin, höchst intime Gespräche führten. Es kam aber auch vor, dass sie in Begleitung von ein oder zwei engen Freundinnen in ihrem Hanomag-Kabriolett plötzlich für fünf oder sechs Wochen zu exotischen Zielen wie Venedig und vor allem Nizza aufbrach. (Wenn sie mir später von dieser Stadt erzählte, gefiel mir besonders der "schicke" Name.) Es überkam sie dann plötzlich ein unstillbares Verlangen nach Ausschweifung, und gelegentlich musste sogar eine ihrer Freundinnen sie daran erinnern, dass in Riga noch Zwillinge im Laufstall auf sie warteten.
Was genau die Damen an der Côte d'Azur anstellten, wusste keiner, nur dass der Aufenthalt im Hotel Negresco an der Promenade des Anglais, dem Treffpunkt des alten russischen Adels an der Riviera, viel Geld kostete. Geld, das der Alte Herr ihr übrigens anstandslos zukommen ließ, wenn sie darum bat. Liest man seine Briefe an sie, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er sie zwar einerseits sehr liebte, andererseits aber auch ganz zufrieden mit der Situation war. Auch er selbst war viel auf Reisen und verstand es meisterhaft, dabei Geschäft und Vergnügen zu verbinden. Und er konnte es sich leisten. Fragen stellten weder er noch sie.
Natürlich musste sich dieser Mangel an familiärem Zusammen halt irgendwann negativ auswirken. Auf welche Weise dies geschah, dürfte aber manchem Pädagogen die Haare zu Berge stehen lassen.
Als die Zwillinge ungefähr sieben Jahre alt waren, stellte der Alte Herr zu seiner Bestürzung fest, dass sie sich untereinander in einer Art russisch-deutscher Gaunersprache verständigten; sie hatten von klein auf eine echte russische njanja mit Namen Anna als Kindermädchen gehabt, und ihre Gouvernante "Eulenka" (Xeno und Jimmy konnten das Wort "Fräulein" nicht aussprechen) war eine Baltin russischer Herkunft. Sowohl vom Vater als auch von der Mutter weitgehend im Stich gelassen, stand diese Eulenka vor der unmöglichen Aufgabe, ganz allein die sprachliche Entwicklung der beiden Kinder in die richtigen Bahnen zu lenken.
Das Deutsche sollte die erste Sprache sein, doch hier lag vieles im Argen: Das "h" lernten die Kinder als "ch" auszusprechen, die Artikel wurden nach dem Vorbild des Russischen weggelassen, aus "ü" wurde "ju", das "o" fiel um eine Oktave ab, in sämtlichen Äußerungen wimmelte es von russischen Interjektionen (nu!, dawai!), und nicht selten wechselten die Jungen ohne Ankündigung vom Deutschen ins Russische oder umgekehrt, wobei sie als Hilfssprache, um die Sache noch komplizierter zu machen, ein wenig vom Personal aufgeschnapptes Lettisch in der Hinterhand hatten.
Und nicht nur den Zwillingen, sondern auch ihren älteren Geschwistern Frans und Titty, von denen erwartet wurde, dass sie an der Städtischen Deutschen Grundschule zu Riga das Hochdeutsche Umbruch lernten, machte es offenbar Spaß, zu Hause mit sämtlichen sprachlichen Regeln Schindluder zu treiben. Dass in diesem babylonischen Karussell kein bisschen Platz mehr für das Niederländische war, verstand sich von selbst. Niederländisch, das war die Sprache des Alten Herrn, die Sprache eines Landes weit hinter dem Horizont, das vor langer Zeit sein Land gewesen war, mit dem aber seine Kinder nichts zu schaffen hatten.
Meinen Großvater störte all dies sehr. Deshalb schickte er Frans und Titty am Ende ihrer Grundschulzeit in die Niederlande, sie sollten dort in der Schule acht Jahre lang einer Art holländischen Gehirnwäsche unterzogen werden. In die Gedanken- und Gefühlswelt meines Opas scheint sich damals eine gewisse Verbitterung eingeschlichen zu haben. Vielleicht meinte er, dass im Tumult der Erfolge seine eigene Herkunft und alles, was damit zusammenhing, zu sehr verblasst sei und von seinen Kindern wie selbstverständlich als unwichtig abgetan werde; vielleicht war es auch eine indirekte Rache an seiner zügellosen Frau. Vielleicht trieb ihn aber noch etwas ganz anderes, nämlich sein glühender Katholizismus, den er im überwiegend lutherischen Lettland nicht wirklich leben konnte.
Aber was auch immer ihn letztlich zu seiner Entscheidung bewogen hat, die Folgen waren jedenfalls für Frans verhängnisvoll.
Während Titty mit zehn ans Instituut Onze Lieve Vrouwe van Lourdes in Voorschoten verbannt wurde, landete mein Vater im Frühsommer 1932 - er war damals elf - bei den Fratres der Congregatio Matris Misericordiae, kurz "Fraters van Tilburg", am Instituut Sint-Nicolaas in Oss. Das war eigentlich ein Kloster; auf Ansichtskarten, die er nach Riga schickte, war ein schlichtes Refektorium mit langen Holztischen zu sehen. Die Jungen, ausnahmslos aus dem gehobenen katholischen Bürgertum, saßen auf Bänken ohne Rückenlehnen. Den Speisesaal beherrschte ein Kruzifix, flankiert durch Skulpturen von Maria und Petrus, an den Wänden hingen Gemälde mit religiösen Motiven. Die Fratres trugen schwarze Kutten und führten ein strenges Regiment; für Sport und Entspannung war nur wenig Zeit vorgesehen, viel weniger jedenfalls als fürs Gebet und die drei täglichen Gottesdienste in der Klosterkapelle, an denen natürlich alle Jungen teilzunehmen hatten.
Für Frans ist der Übergang vom eher zwanglosen Luxusleben mit seinen Freunden aus der baltischen Oberschicht zur langweiligen Bürgerlichkeit des katholischen Landinternats von Anfang an eine Zumutung. Er fühlt sich einsam, weil seine niederländischen Mitschüler ihn, den Fremden, links liegen lassen - und, wenn die Fratres einen Moment nicht aufpassen, gnadenlos schikanieren. Außerdem hat der Alte Herr den Direktor von Sint-Nicolaas, Frater Gerardo, wissen lassen, dass sein Sohn in der Schule in Riga als Schlingel galt. In seinem letzten Zeugnis stand unmissverständlich: "Hat häufig durch Schwatzen und Unruhe den Unterricht gestört." Die Fratres in Oss mögen hier doch bitte korrigierend eingreifen.
Das tun sie, indem sie Fransje, wie er in der Korrespondenz zwischen Gerardo und dem Alten Herrn genannt wird, energisch katechisieren, wofür eigens einer der Mönche, Frater Ildefonso, abgestellt wird. Am Anfang scheint die Maßnahme tatsächlich zum Erfolg zu führen, denn Frans, von so radikalen Veränderungen binnen kurzer Zeit zermürbt, entwickelt einen gewissen Eifer. Er bittet seine Eltern brieflich um ein neues Kniekissen, da er sich offenbar mit einem ausrangierten, verschlissenen Exemplar begnügen muss - die Fratres haben andere Prioritäten -, und nach einigen Wochen beginnt er sogar darüber zu klagen, dass er als Einziger in seiner Klasse noch keine heilige Kommunion empfangen habe.
Von Frater Gerardo darauf angesprochen, teilt der Alte Herr mit, dass sein Sohn dieses Sakrament vom Bischof von Danzig persönlich empfangen solle, der ihn auch getauft habe und ein Freund des Hauses sei, und man deshalb abwarten müsse, bis dieser hohe Geistliche Zeit dafür habe. Woraufhin Gerardo versichert, dass doch das eine das andere nicht ausschließe: "Er kann hier bei uns eine einfache h. Kommunion empfangen und später bei Monseigneur eine feierliche Kommunion, samt Erneuerung der Taufgelöbnisse und Widmung der Heiligen Jungfrau", so steht es wörtlich in dem Brief, und weiter: "Fransje sehnt sich sehr danach, verweigern Sie ihm diese Freude nicht."
Zu dieser Zeit hat Frans schon fast ein halbes Jahr in Einsamkeit hinter sich, sechs Monate, in denen er seine freie Zeit im Lesesaal dazu nutzte, Briefe nach Hause zu schreiben, durchschnittlich sechs bis sieben pro Woche. Sie klingen trostlos, Nachrichten eines verzweifelten Verbannten. So schreibt er nach anderthalb Monaten an seine Mutter: "Ich habe erst zwei Briefe von dir bekommen. Und ich habe schon fünf geschrieben!" An sie schreibt er meistens auf Deutsch, an seinen Vater aus naheliegenden Gründen auf Niederländisch, was ihm allerdings Schwierigkeiten bereitet. Während der gesamten acht Jahre bleibt seine Rechtschreibung fehlerhaft, obwohl er 1933 an das renommierte jesuitische Internat Huize Katwijk in Den Haag wechselt, und weder im Niederländischen noch im Deutschen erreicht er ein befriedigendes Ausdrucksniveau kaum verwunderlich bei dieser Ausgangslage. Dass er an seinen Vater und seine Mutter gesondert schreibt, ist aufschlussreich.
Die Rigaer Freunde vermisst er sehr. Manfred Dolgoi, Hans-Erich Seuberlich und Wolf Meskeris, seine drei besten Kumpel, bekommen von ihm Postkarten mit der verzweifelten Bitte: "Schreib mir mindestens zweimal pro Woche! Auch wenn du nichts zu erzählen hast!" Doch dazu haben diese Heranwachsenden natürlich keine Zeit oder keine Lust, und so tritt eine gewisse Entfremdung ein.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags C.H.Beck
Informationen zu Buch und Autor hier
Der geschäftliche Erfolg ging allerdings mit unerfreulichen Entwicklungen im Privatleben einher. Nach außen, im Umgang mit Fremden, konnte der Alte Herr außerordentlich charmant, weltgewandt und vertrauenerweckend sein. Doch im vertrauten Kreis verhielt er sich reserviert ausgerechnet gegenüber denen, die ihm am nächsten standen, mit Ausnahme seiner Frau, nach der er geradezu verrückt war und der er nichts abschlagen konnte. Mit der Erziehung der Kinder und der Beaufsichtigung des großen Haushalts wollte er möglichst wenig zu tun haben, diese Dinge überließ er am liebsten seiner Frau, und als sich zeigte, dass sie ihrer Verantwortung nicht wirklich nachkam, holte er eine Gouvernante ins Haus. Meine Großmutter, schon von Natur aus sehr auf Selbständigkeit bedacht und voller Aversionen gegen jede Art von Autorität, fühlte sich nämlich mit diesem Tycoon als Ehemann dazu berufen, in der Öffentlichkeit die superemanzipierte Frau zu spielen.
So unternahm sie regelmäßig unangekündigte Reisen, oft zu den Landgütern von Freundinnen in Kurland, wo die Damen, mit meiner Großmutter als Wortführerin, höchst intime Gespräche führten. Es kam aber auch vor, dass sie in Begleitung von ein oder zwei engen Freundinnen in ihrem Hanomag-Kabriolett plötzlich für fünf oder sechs Wochen zu exotischen Zielen wie Venedig und vor allem Nizza aufbrach. (Wenn sie mir später von dieser Stadt erzählte, gefiel mir besonders der "schicke" Name.) Es überkam sie dann plötzlich ein unstillbares Verlangen nach Ausschweifung, und gelegentlich musste sogar eine ihrer Freundinnen sie daran erinnern, dass in Riga noch Zwillinge im Laufstall auf sie warteten.
Was genau die Damen an der Côte d'Azur anstellten, wusste keiner, nur dass der Aufenthalt im Hotel Negresco an der Promenade des Anglais, dem Treffpunkt des alten russischen Adels an der Riviera, viel Geld kostete. Geld, das der Alte Herr ihr übrigens anstandslos zukommen ließ, wenn sie darum bat. Liest man seine Briefe an sie, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er sie zwar einerseits sehr liebte, andererseits aber auch ganz zufrieden mit der Situation war. Auch er selbst war viel auf Reisen und verstand es meisterhaft, dabei Geschäft und Vergnügen zu verbinden. Und er konnte es sich leisten. Fragen stellten weder er noch sie.
Natürlich musste sich dieser Mangel an familiärem Zusammen halt irgendwann negativ auswirken. Auf welche Weise dies geschah, dürfte aber manchem Pädagogen die Haare zu Berge stehen lassen.
Als die Zwillinge ungefähr sieben Jahre alt waren, stellte der Alte Herr zu seiner Bestürzung fest, dass sie sich untereinander in einer Art russisch-deutscher Gaunersprache verständigten; sie hatten von klein auf eine echte russische njanja mit Namen Anna als Kindermädchen gehabt, und ihre Gouvernante "Eulenka" (Xeno und Jimmy konnten das Wort "Fräulein" nicht aussprechen) war eine Baltin russischer Herkunft. Sowohl vom Vater als auch von der Mutter weitgehend im Stich gelassen, stand diese Eulenka vor der unmöglichen Aufgabe, ganz allein die sprachliche Entwicklung der beiden Kinder in die richtigen Bahnen zu lenken.
Das Deutsche sollte die erste Sprache sein, doch hier lag vieles im Argen: Das "h" lernten die Kinder als "ch" auszusprechen, die Artikel wurden nach dem Vorbild des Russischen weggelassen, aus "ü" wurde "ju", das "o" fiel um eine Oktave ab, in sämtlichen Äußerungen wimmelte es von russischen Interjektionen (nu!, dawai!), und nicht selten wechselten die Jungen ohne Ankündigung vom Deutschen ins Russische oder umgekehrt, wobei sie als Hilfssprache, um die Sache noch komplizierter zu machen, ein wenig vom Personal aufgeschnapptes Lettisch in der Hinterhand hatten.
Und nicht nur den Zwillingen, sondern auch ihren älteren Geschwistern Frans und Titty, von denen erwartet wurde, dass sie an der Städtischen Deutschen Grundschule zu Riga das Hochdeutsche Umbruch lernten, machte es offenbar Spaß, zu Hause mit sämtlichen sprachlichen Regeln Schindluder zu treiben. Dass in diesem babylonischen Karussell kein bisschen Platz mehr für das Niederländische war, verstand sich von selbst. Niederländisch, das war die Sprache des Alten Herrn, die Sprache eines Landes weit hinter dem Horizont, das vor langer Zeit sein Land gewesen war, mit dem aber seine Kinder nichts zu schaffen hatten.
Meinen Großvater störte all dies sehr. Deshalb schickte er Frans und Titty am Ende ihrer Grundschulzeit in die Niederlande, sie sollten dort in der Schule acht Jahre lang einer Art holländischen Gehirnwäsche unterzogen werden. In die Gedanken- und Gefühlswelt meines Opas scheint sich damals eine gewisse Verbitterung eingeschlichen zu haben. Vielleicht meinte er, dass im Tumult der Erfolge seine eigene Herkunft und alles, was damit zusammenhing, zu sehr verblasst sei und von seinen Kindern wie selbstverständlich als unwichtig abgetan werde; vielleicht war es auch eine indirekte Rache an seiner zügellosen Frau. Vielleicht trieb ihn aber noch etwas ganz anderes, nämlich sein glühender Katholizismus, den er im überwiegend lutherischen Lettland nicht wirklich leben konnte.
Aber was auch immer ihn letztlich zu seiner Entscheidung bewogen hat, die Folgen waren jedenfalls für Frans verhängnisvoll.
Während Titty mit zehn ans Instituut Onze Lieve Vrouwe van Lourdes in Voorschoten verbannt wurde, landete mein Vater im Frühsommer 1932 - er war damals elf - bei den Fratres der Congregatio Matris Misericordiae, kurz "Fraters van Tilburg", am Instituut Sint-Nicolaas in Oss. Das war eigentlich ein Kloster; auf Ansichtskarten, die er nach Riga schickte, war ein schlichtes Refektorium mit langen Holztischen zu sehen. Die Jungen, ausnahmslos aus dem gehobenen katholischen Bürgertum, saßen auf Bänken ohne Rückenlehnen. Den Speisesaal beherrschte ein Kruzifix, flankiert durch Skulpturen von Maria und Petrus, an den Wänden hingen Gemälde mit religiösen Motiven. Die Fratres trugen schwarze Kutten und führten ein strenges Regiment; für Sport und Entspannung war nur wenig Zeit vorgesehen, viel weniger jedenfalls als fürs Gebet und die drei täglichen Gottesdienste in der Klosterkapelle, an denen natürlich alle Jungen teilzunehmen hatten.
Für Frans ist der Übergang vom eher zwanglosen Luxusleben mit seinen Freunden aus der baltischen Oberschicht zur langweiligen Bürgerlichkeit des katholischen Landinternats von Anfang an eine Zumutung. Er fühlt sich einsam, weil seine niederländischen Mitschüler ihn, den Fremden, links liegen lassen - und, wenn die Fratres einen Moment nicht aufpassen, gnadenlos schikanieren. Außerdem hat der Alte Herr den Direktor von Sint-Nicolaas, Frater Gerardo, wissen lassen, dass sein Sohn in der Schule in Riga als Schlingel galt. In seinem letzten Zeugnis stand unmissverständlich: "Hat häufig durch Schwatzen und Unruhe den Unterricht gestört." Die Fratres in Oss mögen hier doch bitte korrigierend eingreifen.
Das tun sie, indem sie Fransje, wie er in der Korrespondenz zwischen Gerardo und dem Alten Herrn genannt wird, energisch katechisieren, wofür eigens einer der Mönche, Frater Ildefonso, abgestellt wird. Am Anfang scheint die Maßnahme tatsächlich zum Erfolg zu führen, denn Frans, von so radikalen Veränderungen binnen kurzer Zeit zermürbt, entwickelt einen gewissen Eifer. Er bittet seine Eltern brieflich um ein neues Kniekissen, da er sich offenbar mit einem ausrangierten, verschlissenen Exemplar begnügen muss - die Fratres haben andere Prioritäten -, und nach einigen Wochen beginnt er sogar darüber zu klagen, dass er als Einziger in seiner Klasse noch keine heilige Kommunion empfangen habe.
Von Frater Gerardo darauf angesprochen, teilt der Alte Herr mit, dass sein Sohn dieses Sakrament vom Bischof von Danzig persönlich empfangen solle, der ihn auch getauft habe und ein Freund des Hauses sei, und man deshalb abwarten müsse, bis dieser hohe Geistliche Zeit dafür habe. Woraufhin Gerardo versichert, dass doch das eine das andere nicht ausschließe: "Er kann hier bei uns eine einfache h. Kommunion empfangen und später bei Monseigneur eine feierliche Kommunion, samt Erneuerung der Taufgelöbnisse und Widmung der Heiligen Jungfrau", so steht es wörtlich in dem Brief, und weiter: "Fransje sehnt sich sehr danach, verweigern Sie ihm diese Freude nicht."
Zu dieser Zeit hat Frans schon fast ein halbes Jahr in Einsamkeit hinter sich, sechs Monate, in denen er seine freie Zeit im Lesesaal dazu nutzte, Briefe nach Hause zu schreiben, durchschnittlich sechs bis sieben pro Woche. Sie klingen trostlos, Nachrichten eines verzweifelten Verbannten. So schreibt er nach anderthalb Monaten an seine Mutter: "Ich habe erst zwei Briefe von dir bekommen. Und ich habe schon fünf geschrieben!" An sie schreibt er meistens auf Deutsch, an seinen Vater aus naheliegenden Gründen auf Niederländisch, was ihm allerdings Schwierigkeiten bereitet. Während der gesamten acht Jahre bleibt seine Rechtschreibung fehlerhaft, obwohl er 1933 an das renommierte jesuitische Internat Huize Katwijk in Den Haag wechselt, und weder im Niederländischen noch im Deutschen erreicht er ein befriedigendes Ausdrucksniveau kaum verwunderlich bei dieser Ausgangslage. Dass er an seinen Vater und seine Mutter gesondert schreibt, ist aufschlussreich.
Die Rigaer Freunde vermisst er sehr. Manfred Dolgoi, Hans-Erich Seuberlich und Wolf Meskeris, seine drei besten Kumpel, bekommen von ihm Postkarten mit der verzweifelten Bitte: "Schreib mir mindestens zweimal pro Woche! Auch wenn du nichts zu erzählen hast!" Doch dazu haben diese Heranwachsenden natürlich keine Zeit oder keine Lust, und so tritt eine gewisse Entfremdung ein.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags C.H.Beck
Informationen zu Buch und Autor hier
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Miranda July: Auf allen vieren
Miranda July: Auf allen vieren Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung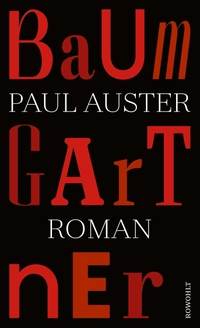 Paul Auster: Baumgartner
Paul Auster: Baumgartner