Als mein Vater vier Jahre alt war, brachte man ihn von einem Dorf an der Atlantikküste in der nordwestspanischen Provinz La Coruña in eine Wohnung in der Avenida Pavón in dem Ort Avellaneda in der Provinz Buenos Aires. Die Wohnung lag im fünften Stock. Zum ersten Mal lebte mein Vater oberhalb des Erdbodens. Vier Jahre in Portosín, auf Meereshöhe, lange Tage auf einem Schiff und schließlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit klapprigen Möbeln, die bloß geliehen waren, wahrscheinlich aber nie zurückgegeben würden. Zu fünft: Seine Mutter, sein Vater, er selbst und seine beiden Schwestern, die jüngerenoch ein Säugling.
Niemand hatte sich darum gekümmert, die Kinder in der Schule anzumelden. Dafür war noch keine Zeit gewesen. Das würde erledigt, wenn sie endgültig eingerichtet wären. Der Vater meines Vaters, mein Großvater, ging auf der Suche nach Arbeit jeden Morgen früh aus dem Haus. Die Mutter war vollauf damit beschäftigt, zu putzen, zu kochen und dafür zu sorgen, dass die Kleine, Esther, gestillt wurde und zu schreien aufhörte. Eladia, die Ältere, zeichnete unterdessen in einem gebrauchten Heft, das ihr Vater für sie besorgt hatte. Mein Vater wiederum vergnügte sich damit, durchs Fenster das Treiben auf der Avenida Pavón zu verfolgen. Busse, Autos, Trambahnen auf der gepflasterten Straße. Leute, die kamen und gingen, auf den Bürgersteigen, genau unter ihm.
An einem dieser bis zum Überdruss gleichförmigen Tage schleifte mein Vater eine Kiste ans Fenster und stieg darauf, um besser hinaussehen zu können. Und während er so über die Tiefe gebeugt dastand, kam ihm der Gedanke, es müsse sich doch herausfinden lassen, wie groß der Abstand zwischen ihm und dem, was sich dort unten bewegte, tatsächlich war. Er stieg von der Kiste und sah sich suchend nach etwas um, was sich hinunterwerfen ließe. Da er nichts Passendes entdecken konnte, ging er in die Küche, zog eine Schublade auf und entnahm ihr ein Messer, mit dem er anschließend, an seiner Mutter vorbei, die gerade mit Stillen beschäftigt war, zur Kiste zurückging. Er stieg wieder hinauf, hielt sich mit der freien Hand am Fensterrahmen fest und sah hinaus. Was sich dort unten ausbreitete, war nicht der Atlantik. Mein Vater hob das Messer, das er bloß mit zwei Fingern am Griff hielt, ein Stück über seinen Kopf, ließ es hin- und herpendeln und rief dazu mit seiner Kinderstimme und unverkennbar spanischem Akzent: "Weg da, ich lass es fallen!"
Und dann ließ er es fallen.
An einem Nachmittag Ende Dezember hörte ich zum ersten Mal von den Treffen, bei denen über die Sache mit dem Fahnendenkmal und den Streit mit der Stadt Rosario gesprochen wurde. Ich war im Club Social von Burzaco und lag dort am Rand der grauen Platten des Sportplatzes, auf dem normalerweise Fußball und Basketball gespielt wurde, um mich, die Badekappe auf dem Kopf, in der Sonne trocknen zu lassen.
Meine Freunde und ich verbrachten den ganzen Sommer im und am Schwimmbecken des Clubs. Meine Mama, mein Papa und mein Bruder auch. Mein Papa allerdings bloß am Wochenende - an manchen Wochenenden. Zuerst spielte er aber immer Tennis. Er gehörte zu den besten Tennisspielern des Clubs, und samstags trat er oft gegen ein anderes Clubmitglied an, das genauso gut spielte wie er. Ich sah nie dabei zu, denn ich konnte es nur schwer ertragen, wenn er verlor, aber nicht weil er dann nicht als Sieger vom Platz ging, sondern aus Angst vor der schlechten Laune, die ihn ergriff. Sie drückte sich nicht in Form von Geschrei aus, sondern im Gegenteil durch vollkommenes Schweigen. Manche meiner Freunde ließen sich jedoch keine dieser samstäglichen Partien entgehen, und schauten hinter dem Drahtzaun zu, als verfolgten sie ein richtiges Profispiel. Tennis war damals in Argentinien nur etwas für Reiche. Mein Vater war aber nicht reich. Er verschaffte sich dieses luxuriöse Vergnügen, weil er es unbedingt wollte, und ließ sich das auch etwas kosten. Das Wertvollste dabei, das, worauf es am sorgfältigsten zu achten galt, weil die Ausgaben für einen Ersatz unweigerlich an anderer Stelle hätten eingespart werden müssen, war der Schläger. Mein Vater hatte einen Jack-Kramer-Schläger der Marke Wilson. Bei uns zu Hause hieß er einfach "der Wilson". Es handelte sich um ein Modell mit Holzrahmen und Darmsaiten. Abgesehen davon, dass manchmal eine dieser Saiten riss oder die Bespannung insgesamt überholt werden musste, stellte Wasser beziehungsweise Feuchtigkeit die größte Bedrohung für den Wilson dar. Deshalb brach mein Vater auch beim ersten Regentropfen jede Partie, ganz egal, wie es stand, sofort ab und ließ den Schläger augenblicklich in seiner Hülle verschwinden oder bedeckte ihn mit einem Handtuch oder, falls nötig, mit seinem eigenen Tennishemd: "Bevor der Wilson kaputtgeht, hol ich mir lieber eine Grippe." Aber nicht nur Regen war gefährlich, die bloße Feuchtigkeit zu manchen Jahreszeiten konnte bereits dafür sorgen, dass der Holzrahmen sich verzog. Deshalb bewahrte mein Vater den Schläger auch immer in einem trapezförmigen Spanner auf, der ebenfalls aus Holz war und sich mithilfe von Flügelschrauben an den vier Ecken so fest verschließen ließ, dass keine Feuchtigkeit der Welt dem Schläger etwas anhaben konnte. Manchmal, wenn mein Vater gut gelaunt war, durfte ich den Wilson einspannen, was ich als große Ehre empfand. So als wollte er mir auf diese Weise zu verstehen geben: "Auf dich kann ich mich wirklich verlassen." Irgendwann merkte ich allerdings, dass er, wenn er glaubte, ich sähe es nicht, überprüfte, ob ich die Schrauben tatsächlich fest genug angezogen hatte und sein Schläger wohlverwahrt war.
Nach dem Spielen duschte mein Vater und kam dann zum Schwimmbecken. Wenn er, das Handtuch über der Schulter, am Beckenrand entlangging, hatte ich den Eindruck, alle Frauen, meine Freundinnen eingeschlossen, beobachteten ihn. Seinen festen Gang, seinen brettharten Bauch, die muskulösen Beine, die allerdings etwas kurz geraten waren, wovon er abzulenken versuchte, indem er Shorts anzog, die höchstens fünf Zentimeter über die Oberschenkel reichten. Wir nannten ihn Gumer, und manchmal fragten Leute, ohne nachzudenken, was das denn für ein ungewöhnlicher Name sei. Obwohlsie mühelos von selbst darauf hätten kommen können, dass Gumer bloß die Abkürzung von Gumersindo war. "Das ist ein schwedischer Name", antwortete mein Vater dann und wiederholte ihn, indem er das u übertrieben kehlig aussprach und stark in die Länge zog: Guuumer. Das war als Witz gemeint, und er lächelte dazu, aber nachdem er für gewöhnlich keine weiteren Erklärungen hinzufügte, nahm ihm offenkundig manch einer seine Behauptung ab.
Auf Höhe der Linie angekommen, wo im Becken der Nichtschwimmerbereich endete, legte er sein Handtuch ab und sprang kopfüber ins Wasser. Immer genau an dieser Stelle. Er war kein guter Schwimmer, deshalb fühlte er sich im tiefen Teil des Beckens, wo man nicht mehr stehen konnte, unsicher, was er jedoch niemals zugegeben hätte. Und wir taten unsererseits, als wüssten wir das nicht. Zur Erklärung sagte er jedes Mal bloß, er springe dort hinein, weil ihm das nun mal so passe. Warum? Darum. Tauchte er kurz danach wieder auf, schwamm er einmal zur anderen Seite hinüber, drehte um, und wieder am Ausgangspunkt angekommen, verließ er das Becken, indem er sich einfach am Rand hochstemmte, statt die Leiter zu benutzen. Meine Mutter dagegen war tatsächlich eine gute Schwimmerin. Aber auch das kommentierten wir nicht, hätte mein Vater sich sonst doch womöglich innerhalb des engen Kreises unserer kleinen Familie unterlegen gefühlt. Von diesen bewussten Auslassungen einmal abgesehen, hatte jedoch unbestreitbar meine Mutter und nicht er meinem Bruder und mir das Schwimmen beigebracht. Meine Mutter beherrschte zwar bloß das Brustschwimmen und hatte uns folglich auch nichts anderes beibringen können, doch uns genügte das, um uns genüsslich auch in den tiefen Teil des Beckens vorzuwagen. Kraulen und Schwimmen im Schmetterlingsstil brachte uns dafür Poldo bei, der Bademeister und Trainer des Schwimmteams des Club Social. Wir Mädchen waren alle in ihn verschossen, und zwar dermaßen, dass wir es sogar hinnahmen, dass er seine Freundin als Assistentin im Verein unterbrachte. Was unsere Liebe zu ihm noch verstärkte, war die Tatsache, dass er sich ein Mädchen ausgesucht hatte, das in unseren Augen nicht halb so gut aussah wie Poldo selbst.
Poldo und mein Vater glichen sich in mehrfacher Hinsicht, wenigstens sah ich das so. Manches davon war offensichtlich und allen bekannt, manches behielt ich dagegen für mich und hätte es auch niemals vor jemand anderem zugegeben: Beide ließen sich mit Kurzformen ihrer Namen ansprechen - Gumer hieß eigentlich Gumersindo, Poldo in Wirklichkeit Leopoldo; beiden schauten die Frauen hinterher; beide sahen viel besser aus als ihre jeweiligen Partnerinnen, also Poldos Freundin wie auch meine Mama.
Das Schwimmbecken im Club Social war fünfundzwanzig Meter lang. Montags durfte man nicht hinein, weil dann das Wasser gewechselt wurde. Aus diesem Grund war das Wasser dienstags immer eiskalt, während es sich sonntags als mehr oder weniger intensiv grüne lauwarme Brühe präsentierte, je nachdem, wie faulig das gechlorte Wasser bis dahin geworden war. Nichts davon machte uns etwas aus. Das Beste, was es für uns gab, war dieses Schwimmbecken, und zwar deshalb, weil wir uns dort immer alle trafen. Und das Einzige, was uns davon abhalten konnte, war der Fußpilz. Alle zwei Wochenmussten wir uns deshalb ärztlich untersuchen lassen, und falls irgendwo zwischen den Zehen verräterische Schuppen oder rötliche Flecken auftauchten, mussten wir uns schleunigst einer Behandlung unterziehen und anschließend mit dem Schwimmen aussetzen und die nächste Untersuchung abwarten. Von der Benutzung des Schwimmbeckens ausgeschlossen zu sein,war das Schlimmste, was einem passieren konnte, denn das Schwimmbecken war die Welt, um die sich für uns alles drehte. Um das zu verhindern, waren wir zu allem Möglichen und Unmöglichen bereit. Ich zumindest. Mein Großvater väterlicherseits starb genau an dem Tag, an dem in jenem Jahr die erste ärztliche Untersuchung für die bevorstehende Badesaison angesetzt war. Meine Eltern hatten damals schon sehr früh das Haus verlassen, und ich hatte nicht gewagt, sie auf das Thema anzusprechen. Der Tag verging, und meine Eltern kehrten nicht zurück. Als mein Verdacht, sie würden nicht rechtzeitig wieder da sein, endgültig Gewissheit zu werden drohte, fing ich an, auf meine Großmutter einzureden, damit sie mit mir zur Totenwache fuhr. Ich hörte erst auf, als ich mein Ziel erreicht hatte. Die ärztliche Untersuchung erwähnte ich allerdings mit keinem Wort. Schließlich machte meine Großmutter sich mit mir auf den Weg. Eine Weile stand ich neben dem aufgebahrten Leichnam. Ich betete, als die anderen beteten. Ich küsste meine Hand und legte sie auf die kalte Stirn meines Großvaters. Und bevor ich wieder ging, fragte ich meine Mutter wie beiläufig - natürlich sollte sie keinesfalls merken, was der eigentliche Grund für mein Kommen gewesen war -, wo mein Club-Ausweis sei und ob sie mir das Geld für den neuen Mitgliedsbeitrag geben könne. "Muss das heute sein?", fragte sie. Ich antwortete nicht, aber mir traten die Tränen in die Augen. Sie sagte auch nichts weiter. Dafür ging sie widerstrebend zu meinem Vater und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Ich fürchtete mich schon vor seiner Reaktion, selbst wenn diese bloß in einem stummen Blick von der Stelle aus bestünde, an der er sich gerade befand - am Fußende des Sargs. Aber, ohne zu mir hinüberzusehen, schob mein Vater bloß die Hand in die Tasche, zog mehrere Scheine heraus, gab sie meiner Mutter und sprach dann mit einem Mann, der gerade zu ihm getreten war. Ich ergriff das Geld, das meine Mutter mir hinhielt, schloss die Faust um die Scheine und ging so davon. Während der Rückfahrt im Bus mit meiner Großmutter hatte ich das ungute Gefühl, die Strafe werde nicht auf sich warten lassen. Aber nichts dergleichen geschah. Ich traf noch rechtzeitig im Club ein, bezahlte den vollständigen Beitrag, der Arzt untersuchte mich, stempelte meinen Mitgliedsausweis ab und setzte seine Unterschrift darauf. Der nächste Sommer konnte beginnen.
zu Leseprobe Teil 3
Niemand hatte sich darum gekümmert, die Kinder in der Schule anzumelden. Dafür war noch keine Zeit gewesen. Das würde erledigt, wenn sie endgültig eingerichtet wären. Der Vater meines Vaters, mein Großvater, ging auf der Suche nach Arbeit jeden Morgen früh aus dem Haus. Die Mutter war vollauf damit beschäftigt, zu putzen, zu kochen und dafür zu sorgen, dass die Kleine, Esther, gestillt wurde und zu schreien aufhörte. Eladia, die Ältere, zeichnete unterdessen in einem gebrauchten Heft, das ihr Vater für sie besorgt hatte. Mein Vater wiederum vergnügte sich damit, durchs Fenster das Treiben auf der Avenida Pavón zu verfolgen. Busse, Autos, Trambahnen auf der gepflasterten Straße. Leute, die kamen und gingen, auf den Bürgersteigen, genau unter ihm.
An einem dieser bis zum Überdruss gleichförmigen Tage schleifte mein Vater eine Kiste ans Fenster und stieg darauf, um besser hinaussehen zu können. Und während er so über die Tiefe gebeugt dastand, kam ihm der Gedanke, es müsse sich doch herausfinden lassen, wie groß der Abstand zwischen ihm und dem, was sich dort unten bewegte, tatsächlich war. Er stieg von der Kiste und sah sich suchend nach etwas um, was sich hinunterwerfen ließe. Da er nichts Passendes entdecken konnte, ging er in die Küche, zog eine Schublade auf und entnahm ihr ein Messer, mit dem er anschließend, an seiner Mutter vorbei, die gerade mit Stillen beschäftigt war, zur Kiste zurückging. Er stieg wieder hinauf, hielt sich mit der freien Hand am Fensterrahmen fest und sah hinaus. Was sich dort unten ausbreitete, war nicht der Atlantik. Mein Vater hob das Messer, das er bloß mit zwei Fingern am Griff hielt, ein Stück über seinen Kopf, ließ es hin- und herpendeln und rief dazu mit seiner Kinderstimme und unverkennbar spanischem Akzent: "Weg da, ich lass es fallen!"
Und dann ließ er es fallen.
An einem Nachmittag Ende Dezember hörte ich zum ersten Mal von den Treffen, bei denen über die Sache mit dem Fahnendenkmal und den Streit mit der Stadt Rosario gesprochen wurde. Ich war im Club Social von Burzaco und lag dort am Rand der grauen Platten des Sportplatzes, auf dem normalerweise Fußball und Basketball gespielt wurde, um mich, die Badekappe auf dem Kopf, in der Sonne trocknen zu lassen.
Meine Freunde und ich verbrachten den ganzen Sommer im und am Schwimmbecken des Clubs. Meine Mama, mein Papa und mein Bruder auch. Mein Papa allerdings bloß am Wochenende - an manchen Wochenenden. Zuerst spielte er aber immer Tennis. Er gehörte zu den besten Tennisspielern des Clubs, und samstags trat er oft gegen ein anderes Clubmitglied an, das genauso gut spielte wie er. Ich sah nie dabei zu, denn ich konnte es nur schwer ertragen, wenn er verlor, aber nicht weil er dann nicht als Sieger vom Platz ging, sondern aus Angst vor der schlechten Laune, die ihn ergriff. Sie drückte sich nicht in Form von Geschrei aus, sondern im Gegenteil durch vollkommenes Schweigen. Manche meiner Freunde ließen sich jedoch keine dieser samstäglichen Partien entgehen, und schauten hinter dem Drahtzaun zu, als verfolgten sie ein richtiges Profispiel. Tennis war damals in Argentinien nur etwas für Reiche. Mein Vater war aber nicht reich. Er verschaffte sich dieses luxuriöse Vergnügen, weil er es unbedingt wollte, und ließ sich das auch etwas kosten. Das Wertvollste dabei, das, worauf es am sorgfältigsten zu achten galt, weil die Ausgaben für einen Ersatz unweigerlich an anderer Stelle hätten eingespart werden müssen, war der Schläger. Mein Vater hatte einen Jack-Kramer-Schläger der Marke Wilson. Bei uns zu Hause hieß er einfach "der Wilson". Es handelte sich um ein Modell mit Holzrahmen und Darmsaiten. Abgesehen davon, dass manchmal eine dieser Saiten riss oder die Bespannung insgesamt überholt werden musste, stellte Wasser beziehungsweise Feuchtigkeit die größte Bedrohung für den Wilson dar. Deshalb brach mein Vater auch beim ersten Regentropfen jede Partie, ganz egal, wie es stand, sofort ab und ließ den Schläger augenblicklich in seiner Hülle verschwinden oder bedeckte ihn mit einem Handtuch oder, falls nötig, mit seinem eigenen Tennishemd: "Bevor der Wilson kaputtgeht, hol ich mir lieber eine Grippe." Aber nicht nur Regen war gefährlich, die bloße Feuchtigkeit zu manchen Jahreszeiten konnte bereits dafür sorgen, dass der Holzrahmen sich verzog. Deshalb bewahrte mein Vater den Schläger auch immer in einem trapezförmigen Spanner auf, der ebenfalls aus Holz war und sich mithilfe von Flügelschrauben an den vier Ecken so fest verschließen ließ, dass keine Feuchtigkeit der Welt dem Schläger etwas anhaben konnte. Manchmal, wenn mein Vater gut gelaunt war, durfte ich den Wilson einspannen, was ich als große Ehre empfand. So als wollte er mir auf diese Weise zu verstehen geben: "Auf dich kann ich mich wirklich verlassen." Irgendwann merkte ich allerdings, dass er, wenn er glaubte, ich sähe es nicht, überprüfte, ob ich die Schrauben tatsächlich fest genug angezogen hatte und sein Schläger wohlverwahrt war.
Nach dem Spielen duschte mein Vater und kam dann zum Schwimmbecken. Wenn er, das Handtuch über der Schulter, am Beckenrand entlangging, hatte ich den Eindruck, alle Frauen, meine Freundinnen eingeschlossen, beobachteten ihn. Seinen festen Gang, seinen brettharten Bauch, die muskulösen Beine, die allerdings etwas kurz geraten waren, wovon er abzulenken versuchte, indem er Shorts anzog, die höchstens fünf Zentimeter über die Oberschenkel reichten. Wir nannten ihn Gumer, und manchmal fragten Leute, ohne nachzudenken, was das denn für ein ungewöhnlicher Name sei. Obwohlsie mühelos von selbst darauf hätten kommen können, dass Gumer bloß die Abkürzung von Gumersindo war. "Das ist ein schwedischer Name", antwortete mein Vater dann und wiederholte ihn, indem er das u übertrieben kehlig aussprach und stark in die Länge zog: Guuumer. Das war als Witz gemeint, und er lächelte dazu, aber nachdem er für gewöhnlich keine weiteren Erklärungen hinzufügte, nahm ihm offenkundig manch einer seine Behauptung ab.
Auf Höhe der Linie angekommen, wo im Becken der Nichtschwimmerbereich endete, legte er sein Handtuch ab und sprang kopfüber ins Wasser. Immer genau an dieser Stelle. Er war kein guter Schwimmer, deshalb fühlte er sich im tiefen Teil des Beckens, wo man nicht mehr stehen konnte, unsicher, was er jedoch niemals zugegeben hätte. Und wir taten unsererseits, als wüssten wir das nicht. Zur Erklärung sagte er jedes Mal bloß, er springe dort hinein, weil ihm das nun mal so passe. Warum? Darum. Tauchte er kurz danach wieder auf, schwamm er einmal zur anderen Seite hinüber, drehte um, und wieder am Ausgangspunkt angekommen, verließ er das Becken, indem er sich einfach am Rand hochstemmte, statt die Leiter zu benutzen. Meine Mutter dagegen war tatsächlich eine gute Schwimmerin. Aber auch das kommentierten wir nicht, hätte mein Vater sich sonst doch womöglich innerhalb des engen Kreises unserer kleinen Familie unterlegen gefühlt. Von diesen bewussten Auslassungen einmal abgesehen, hatte jedoch unbestreitbar meine Mutter und nicht er meinem Bruder und mir das Schwimmen beigebracht. Meine Mutter beherrschte zwar bloß das Brustschwimmen und hatte uns folglich auch nichts anderes beibringen können, doch uns genügte das, um uns genüsslich auch in den tiefen Teil des Beckens vorzuwagen. Kraulen und Schwimmen im Schmetterlingsstil brachte uns dafür Poldo bei, der Bademeister und Trainer des Schwimmteams des Club Social. Wir Mädchen waren alle in ihn verschossen, und zwar dermaßen, dass wir es sogar hinnahmen, dass er seine Freundin als Assistentin im Verein unterbrachte. Was unsere Liebe zu ihm noch verstärkte, war die Tatsache, dass er sich ein Mädchen ausgesucht hatte, das in unseren Augen nicht halb so gut aussah wie Poldo selbst.
Poldo und mein Vater glichen sich in mehrfacher Hinsicht, wenigstens sah ich das so. Manches davon war offensichtlich und allen bekannt, manches behielt ich dagegen für mich und hätte es auch niemals vor jemand anderem zugegeben: Beide ließen sich mit Kurzformen ihrer Namen ansprechen - Gumer hieß eigentlich Gumersindo, Poldo in Wirklichkeit Leopoldo; beiden schauten die Frauen hinterher; beide sahen viel besser aus als ihre jeweiligen Partnerinnen, also Poldos Freundin wie auch meine Mama.
Das Schwimmbecken im Club Social war fünfundzwanzig Meter lang. Montags durfte man nicht hinein, weil dann das Wasser gewechselt wurde. Aus diesem Grund war das Wasser dienstags immer eiskalt, während es sich sonntags als mehr oder weniger intensiv grüne lauwarme Brühe präsentierte, je nachdem, wie faulig das gechlorte Wasser bis dahin geworden war. Nichts davon machte uns etwas aus. Das Beste, was es für uns gab, war dieses Schwimmbecken, und zwar deshalb, weil wir uns dort immer alle trafen. Und das Einzige, was uns davon abhalten konnte, war der Fußpilz. Alle zwei Wochenmussten wir uns deshalb ärztlich untersuchen lassen, und falls irgendwo zwischen den Zehen verräterische Schuppen oder rötliche Flecken auftauchten, mussten wir uns schleunigst einer Behandlung unterziehen und anschließend mit dem Schwimmen aussetzen und die nächste Untersuchung abwarten. Von der Benutzung des Schwimmbeckens ausgeschlossen zu sein,war das Schlimmste, was einem passieren konnte, denn das Schwimmbecken war die Welt, um die sich für uns alles drehte. Um das zu verhindern, waren wir zu allem Möglichen und Unmöglichen bereit. Ich zumindest. Mein Großvater väterlicherseits starb genau an dem Tag, an dem in jenem Jahr die erste ärztliche Untersuchung für die bevorstehende Badesaison angesetzt war. Meine Eltern hatten damals schon sehr früh das Haus verlassen, und ich hatte nicht gewagt, sie auf das Thema anzusprechen. Der Tag verging, und meine Eltern kehrten nicht zurück. Als mein Verdacht, sie würden nicht rechtzeitig wieder da sein, endgültig Gewissheit zu werden drohte, fing ich an, auf meine Großmutter einzureden, damit sie mit mir zur Totenwache fuhr. Ich hörte erst auf, als ich mein Ziel erreicht hatte. Die ärztliche Untersuchung erwähnte ich allerdings mit keinem Wort. Schließlich machte meine Großmutter sich mit mir auf den Weg. Eine Weile stand ich neben dem aufgebahrten Leichnam. Ich betete, als die anderen beteten. Ich küsste meine Hand und legte sie auf die kalte Stirn meines Großvaters. Und bevor ich wieder ging, fragte ich meine Mutter wie beiläufig - natürlich sollte sie keinesfalls merken, was der eigentliche Grund für mein Kommen gewesen war -, wo mein Club-Ausweis sei und ob sie mir das Geld für den neuen Mitgliedsbeitrag geben könne. "Muss das heute sein?", fragte sie. Ich antwortete nicht, aber mir traten die Tränen in die Augen. Sie sagte auch nichts weiter. Dafür ging sie widerstrebend zu meinem Vater und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Ich fürchtete mich schon vor seiner Reaktion, selbst wenn diese bloß in einem stummen Blick von der Stelle aus bestünde, an der er sich gerade befand - am Fußende des Sargs. Aber, ohne zu mir hinüberzusehen, schob mein Vater bloß die Hand in die Tasche, zog mehrere Scheine heraus, gab sie meiner Mutter und sprach dann mit einem Mann, der gerade zu ihm getreten war. Ich ergriff das Geld, das meine Mutter mir hinhielt, schloss die Faust um die Scheine und ging so davon. Während der Rückfahrt im Bus mit meiner Großmutter hatte ich das ungute Gefühl, die Strafe werde nicht auf sich warten lassen. Aber nichts dergleichen geschah. Ich traf noch rechtzeitig im Club ein, bezahlte den vollständigen Beitrag, der Arzt untersuchte mich, stempelte meinen Mitgliedsausweis ab und setzte seine Unterschrift darauf. Der nächste Sommer konnte beginnen.
zu Leseprobe Teil 3
Kommentieren








 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Miranda July: Auf allen vieren
Miranda July: Auf allen vieren Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung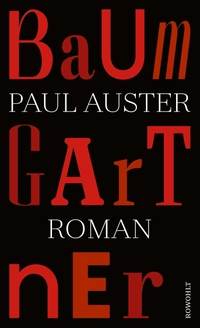 Paul Auster: Baumgartner
Paul Auster: Baumgartner